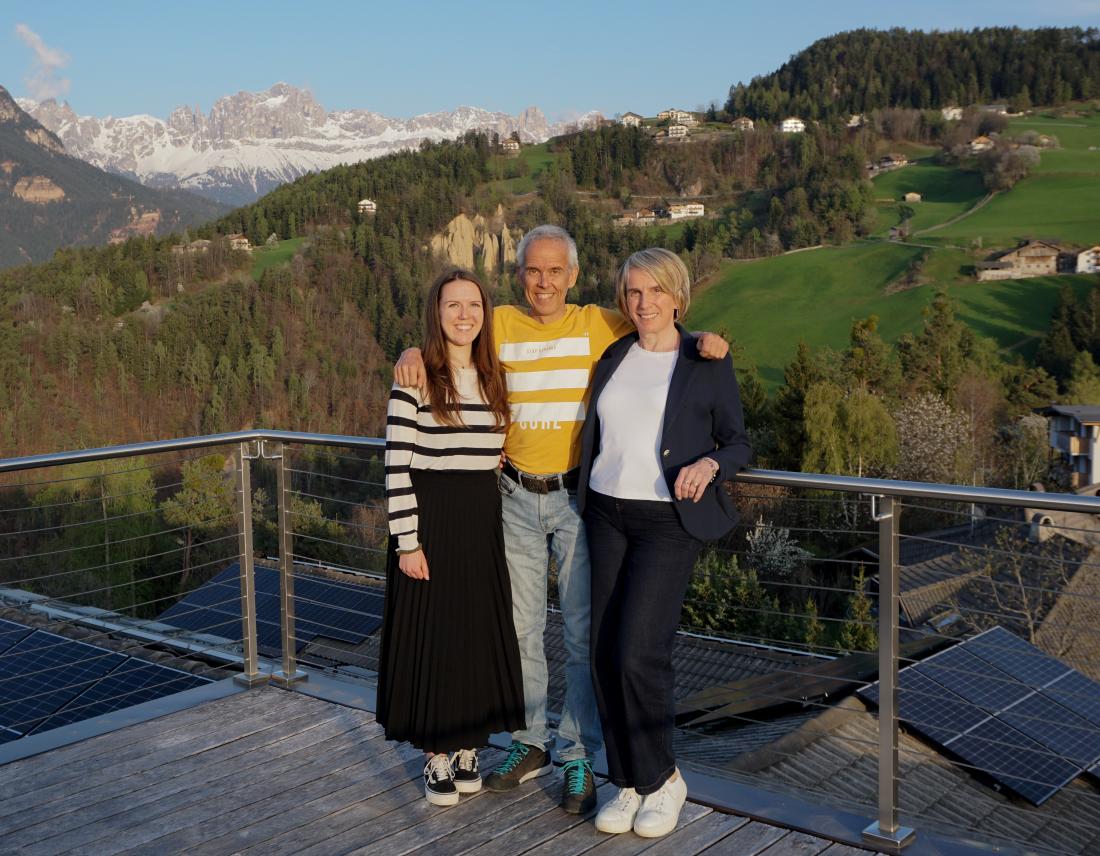Der härteste Gegner im Kampf für eine bessere Zukunft sitzt nicht automatisch an den Schalthebeln der Macht. Weniger Fleisch essen, weniger Fernreisen, bewusster konsumieren: Eigentlich wissen wir, wie klima- und umweltfreundliches Verhalten funktioniert. Aber warum machen wir es dann nicht einfach? Das besprechen wir mit Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke.
Wieso klaffen gerade bei der Klimakrise Wissen und Handeln oft weit auseinander? Welche Faktoren beeinflussen unser umweltfreundliches Verhalten? Wie gehen wir mit der Diskrepanz zwischen Einstellung und Konsumverhalten um? Kann durch „Wachrütteln mit Fakten“ eine Bereitschaft zu einem umweltfreundlichen Lebensstil erreicht werden? Und wie schaffen wir es, unseren inneren Umweltschweinehund zu überwinden? Spannende Fragen wir diese werden in dem Buch „Warum machen wir es nicht einfach?“ der Umweltpsychogin Isabella Uhl-Hädicke beantwortet. Die Salzburgerin und zweifache Mutter berät Unternehmen und Politik, ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Klimarats des Bundesministeriums für Klimaschutz und wurde 2021 zur „Österreicherin des Jahres“ nominiert. Wir haben ihr fünf Fragen gestellt, die uns schon lange unter den Fingernägeln brennen.
Von den „Klimakleber:innen“ der Letzen Generation bis hin zu Greta Thunberg – junge Menschen kämpfen für ihre Zukunft und polarisieren dabei extrem. Muss man zu drastischen Mitteln greifen, um wachzurütteln?
Oft fühlen sich Menschen von den Aktionen vor den Kopf gestoßen, da sie die Klimakrise direkt im Alltag präsent machen. Dies löst ein unangenehmes Gefühl beziehungweise ein schlechtes Gewissen aus. Dieser Zwiespalt löst eine sogenannte kognitive Dissonanz aus, einen inneren Konflikt bei den Menschen, darob, wie sie handeln sollen und wie sie dann tatsächlich handeln. Idealerweise lösen sie das so, dass sie ihr Verhalten anpassend – oder aber sie finden Ausreden im Sinne der Kompensation: Ich fahre einen Benziner, aber ich esse nur Biofleisch. Eine andere Methode ist sind Aggressionen gegenüber all jenen, die Fakten aufzeigen. Das kann man gerade im Umgang mit den Klimaaktivist:innen beobachten.


Der SUV, der Ferienflieger ins Luxusdomizil, eine Yacht, exotische, importierte Lebensmittel – was früher (und bei manchen immer noch) als Statussymbol betrachtet wird, steht im Kreuzfeuer der Kritik. Ist eine Kehrtwende in dieser Zielgruppe überhaupt möglich?
Nur sehr schwer. Ein Weltbild wurde aufgebaut, eine Vorstellung davon, was ein gutes Leben bedeuten kann. Und das steht nun im Gegensatz zu dem, was es braucht, um eine lebenswerte Zukunft zu erhalten. Gerne zeigt man mit dem Finger auf andere, sucht Fehler bei ihnen. Wir müssen uns von dem Anspruch lösen, dass jemand nur „mitreden“ darf, wenn sein Lebensstil zu hundert Prozent richtig ist. Denn dies ist im gegenwärtigen System ohnehin nicht möglich. Wir konnten in unseren Forschungen außerdem zeigen, dass Informationen zum Klimawandel den Ethnozentrismus erhöhen, nach dem Motto „Wir sind besser als die.“ Dies führt bei Personen dann eher dazu, dass sie sich verteidigen anstatt konstruktiv nach Lösungsansätzen im Zusammenhang mit der Klimakrise suchen. Zusammenfassend kann man sagen: Informationen können auf einer ganz anderen Ebene als beabsichtigt wirken, das sollten NGOs und Aktivist:innen in ihrer Kommunikation berücksichtigen. Sie sprechen die Menschen so an, wie sie sich selbst ansprechen würden. All jene mit einem anderen Werteset werden dabei oft nicht abgeholt. Der Klimawandel darf aber nicht das Thema einer Bubble sein, die eine bestimmte politische Einstellung teilt, er ist ein wichtiges Anliegen für die Breite der Gesellschaft.
Neigen wir zum Verdrängen? Warum sehen wir gerade im heißen Hochsommer die Klimaerwärmung als Problem und hören quasi beim ersten Regen damit auf?
Die Herausforderung ist, dass der Alltag dazwischenkommt. Die Umweltpsychologie zeigt, dass es nur zu einer Verhaltensänderung kommt, wenn wir selbst einen gewissen Leidensdruck spüren. Das ist auch die große Herausforderung beim Kampf gegen den inneren Umweltschweinehund. Wir spüren die Konsequenzen meist nicht unmittelbar. Wenn ich jetzt, in diesem Moment, meinen Lebensstil umstelle, wird es auf das Klima in der Zukunft einen Einfluss haben. Und das auch nur, wenn es eine gewisse Anzahl von Personen macht. Das macht es auch so schwierig für uns. Deshalb ist es wichtig, in der Kommunikation von tatsächlichen Problemen und Fakten greifbar zu bleiben. Wir alle kennen das Foto des abgemagerten Eisbären auf einer Scholle. Das trifft, aber nur kurz. Zeigen wir ein Bild der veränderten Umwelt im direkten Umfeld, hat das eine ganz andere Wirkung. Das Klima zu schützen, ist keine altruistische Handlung, es geht ganz konkret um unsere Zukunft in unserer jeweiligen Heimat. Außerdem ist es wichtig, die globalen Zusammenhänge aufzuzeigen. Ein Beispiel: Waldbrände in Brasilien. Vielen war nicht nicht bewusst, dass ihr Konsumverhalten und ihre Ernährung damit zusammenhängen, weil die Flächen für die Sojaproduktion gerodet werden – als Futtermittel für Tiere, die auf unserem Teller landen.
Welche Schalthebeln gibt es denn noch?
Man muss im Hinterkopf behalten, dass es schlicht und ergreifend Ohnmacht und Resignation auslöst, wenn immer nur Bad News berichtet werden. Besser ist es, Lösungswege zu vermitteln. Studien zeigen, dass in der Berichterstattung über Klimaveränderung die aufgezeigten Lösungen unter zehn Prozent liegen. Das muss sich ändern. Außerdem ist nicht die Nachricht an sich essenziell, sondern die Frage, wer da wie kommuniziert. Das nimmt für Personen eine viel wichtigere Rolle ein, als die Fakten an sich.
Können Einzelpersonen überhaupt etwas bewegen?
Handlungen auf politischer und auf wirtschaftlicher Ebene sind unumgänglich. Doch auch Einzelpersonen müssen ihre Verantwortung annehmen. Man schafft dadurch eine Gegenstrategie zur Ohnmacht. Wir alle können Denkprozesse anstoßen und Vorbild sein. Wenn ich ein Selfie aus dem Zug poste, in die Arbeit komme und den Fahrradhelm auf den Tisch lege, dann sind das Hinweisreize, die zeigen, was möglich ist. Ohne Fingerzeig, ohne Überlegenheitsgefühl. Natürlich ändert sich nichts von heute auf morgen – es ist nachvollziehbar, dass das frustriert. Aber die Forschung zeigt, dass das Verhalten, das wir in unserem Umfeld beobachten auch das eigene Verhalten motiviert. Und: Was wäre die Alternative? Aufgeben und die Konsequenzen der Klimakrise hinnehmen? Man sollte tun, was in der eigenen Macht steht.